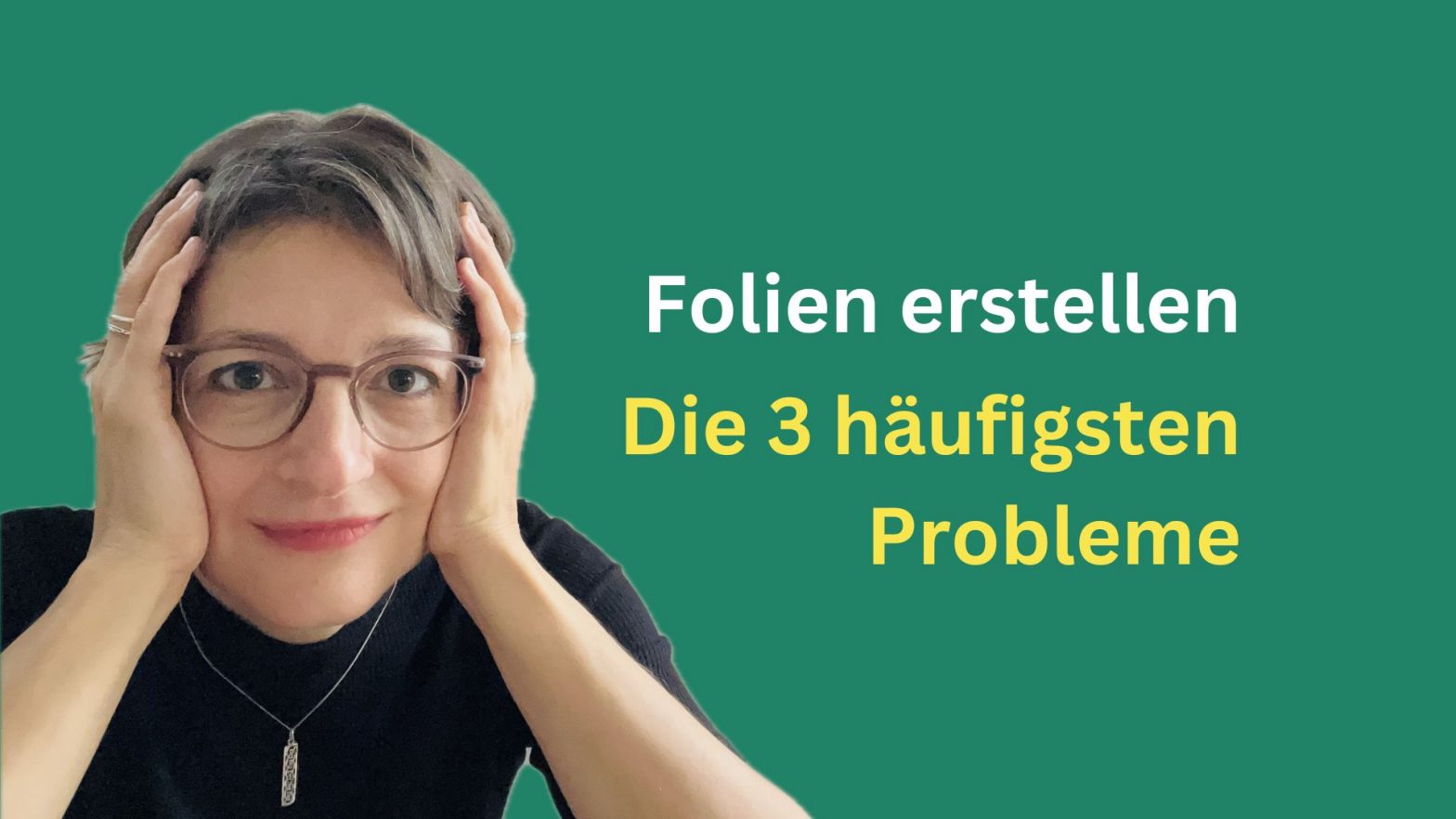Die Zeit drängt. Nächste Woche ist schon dein wissenschaftlicher Vortrag auf der Konferenz, für die du dich angemeldet hast, und du hast noch nicht wirklich mit deinen Folien angefangen. Obwohl du darauf brennst, deine neuesten Forschungsergebnisse endlich einem Fachpublikum vorzustellen. Du musstest noch einige Zellexperimente abschließen, einen Forschungsbericht einreichen oder Fragen von Reviewern zu deiner eingereichten Publikation beantworten. Alles scheint zunächst wichtiger zu sein als deine Folien.
Was machst du vielleicht als nächstes? Du öffnest schnell PowerPoint, wählst eine Standard-Vorlage mit dem Design deiner Uni oder das deiner Firma. Vielleicht sogar das der Konferenz, das die Organisatoren dir schon vor über einem Monat zugeschickt hatten. Und dann legst du los: den Titel aus dem eingereichten Abstract auf die erste Seite, ein paar Grundlagen-Folien aus einem alten Vortrag, ein neues Diagramm mit deinen Forschungsergebnissen hier, ein paar erste Stichpunkte dort, noch schnell eine Tabelle rein. Hauptsache es stehen schon ein paar Folien.
Das ist verständlich. Schließlich drängt die Zeit. Das schnelle Zusammenklicken der Folien fühlt sich produktiv an – doch es beraubt dich eines entscheidenden Wirkmittels: durchdachtes Foliendesign als Verstärker deiner Aussagen. Denn gute Inhalte wirken erst richtig mit einer passenden Gestaltung.
In diesem Artikel zeige ich dir drei der häufigsten Probleme, die beim Erstellen wissenschaftlicher Folien immer wieder auftauchen – auch bei erfahrenen Vortragenden. Und ich zeige dir, wie du sie ganz pragmatisch löst – egal ob du viel Zeit hast für deine Folien oder nicht.
Problem 1: Du fängst direkt mit den Folien statt mit der Vortragsstruktur an
Das häufigste Problem beim Erstellen wissenschaftlicher Folien: Viele starten direkt mit dem Design. Wer gleich PowerPoint öffnet, das Template anpasst und erste Inhalte platziert, hat schnell das Gefühl, fast fertig zu sein. In Wahrheit bist du nur gestalterisch aktiv, bevor du dich inhaltlich mit dem Vortrag auseinandergesetzt hast.
Warum das ein Problem ist
Am Anfang fühlt es sich vielleicht noch produktiv an, sofort mit Folien loszulegen. Doch die Nachteile zeigen sich schnell:
- Mehr Zeitaufwand: Du baust Folien, die du später wieder löschst oder komplett umbaust. Am Ende hast du viele Stunden investiert – aber das Gefühl, kaum vorangekommen zu sein. Das frisst nicht nur Zeit sondern raubt auch Energie und kostet Nerven.
- Falscher Fokus: Du verschiebst Kästen, probierst Farben – und merkst nicht mehr, dass du eigentlich nur am Layout tüftelst statt an deiner Botschaft. Dabei solltest du dich eigentlich auf deine Argumentation konzentrieren.
- Innere Unsicherheit: Je näher die Deadline rückt, desto mehr wächst das Gefühl, dass der Vortrag nicht ganz rund ist. Aus Nervosität werden schnell Selbstzweifel, vielleicht sogar Panik.
So löst du dieses erste Problem
Überlege zuerst, was dein Publikum mitnehmen soll – und welche Struktur das möglich macht. Ein klarer roter Faden sorgt dafür, dass dein Publikum dir folgen kann und Inhalte im Gedächtnis bleiben. Das gelingt auch unter Zeitdruck.
Anstatt mit dem Foliendesign loszulegen, arbeite am Vortragskonzept und gehe erst einmal die folgenden 7 Schritte durch:
- Analysiere die Ausgangssituation: Welche Forschungsdaten könntest du eigentlich alle zeigen? Wer ist dein Publikum und was kennt es bereits aus der Literatur? Wie viel Zeit steht dir zur Verfügung, was ist das Thema deiner Session? Wer spricht vor dir über welches Thema? Es hilft, das alles erst einmal zu sammeln, um sich einen Überblick zu verschaffen. Diesen Schritt solltest du auf keinen Fall auslassen – egal wie sehr die Zeit drängt.
- Formuliere Take-Home-Messages: Welche verschiedenen Botschaften kannst du für dein Publikum formulieren, die unbedingt im Kopf bleiben sollen? Wenn du Details einer von dir entwickelten Methode vorstellen möchtest, ist die Botschaft eine andere, als wenn du über die Relevanz für die praktische Anwendung sprechen willst. Sei kreativ und notiere einmal alle möglichen Take-Home-Messages. Wenn die Zeit knapp ist, entscheide dich für die, bei der du dich am sichersten fühlst.
- Entwirf verschiedene Vortragsskizzen: Wie könntest du deine Botschaft erzählen? Welche Wege führen dein Publikum durch deinen Vortrag? Die typische Struktur „Einleitung – Methoden – Ergebnisse – Diskussion – Fazit“ ist eine sichere Bank für Wissenschaftler/innen – aber leider auch sehr vorhersehbar und daher etwas langweilig. Alternativ startest du mit einem Problem, zeigst deinen Lösungsansatz und diskutierst die Relevanz. Oder du beginnst mit einer zentralen Frage, zeigst wie du sie untersucht hast, präsentierst Aha-Momente und bietest einen Ausblick. Halte unterschiedliche Varianten fest – als Mindmap, Ablaufdiagramm oder Argumentationsleitfaden.
- Entwickle den roten Faden: Wie lässt sich dein Vortrag so aufbauen, dass er logisch und nachvollziehbar bleibt? Welche Reihenfolge deiner Themen führt dein Publikum sicher durch deine Argumentation? Und an welcher Stelle ergibt es Sinn, Schwerpunkte zu setzen oder Inhalte zu bündeln? In diesem Schritt prüfst du deine Skizzen kritisch. Ordne deine Themen so, dass sie aufeinander aufbauen und deine Kernbotschaft Schritt für Schritt herleiten. Deine Struktur muss noch nicht final sein, aber sie sollte konsistent bleiben und dir Orientierung für die weiteren Schritte geben.
- Lege die Inhalte fest: Was ist für dein Publikum wirklich relevant und lässt sich nachvollziehbar präsentieren? Und was nicht? Hier musst du dich entscheiden, welche Daten du zeigst, und welche du bewusst weglässt. Das ist für uns Wissenschaftler/innen nicht ganz leicht, da wir am liebsten alles zeigen würden. Nicht unbedingt, weil wir damit unsere Expertise zeigen wollen. Sondern weil wir an eine detaillierte Beweisführung gewöhnt sind, um die Korrektheit unserer Daten zu belegen. Doch ein Vortrag ist keine wissenschaftliche Abhandlung wie für ein Peer-Review-Journal. In diesem Schritt sortierst du gnadenlos aus, was thematisch in deinen Vortrag gehört und was nicht. Wenn du viel Zeit und auch Lust am Experimentieren hast, kannst du hier für jede Vortragsskizze und Take-Home-Message die jeweiligen Inhalte festlegen.
- Wähle passende Übergänge aus: Wie verbindest du die einzelnen Inhalte deines Vortrags? Was sind gute Überleitungen? Gerade bei kreativeren Vortragsstrukturen hast du viele Möglichkeiten – manchmal auch so viele, dass du dich nicht entscheiden kannst. Wenn du mit der Schilderung eines Problems anfängst, kannst du danach entweder beschreiben, welche Lösungsansätze es noch gibt und deren Vor- und Nachteile schildern. Oder du steigst direkt bei deinen Ergebnissen ein und vergleichst mit anderen Methoden gegen Ende deines Vortrags. Deswegen ist es so wichtig, sich bereits zu Anfang klar zu machen, welche Botschaft du vermitteln möchtest, wie viel Zeit du hast, wer zuhört usw.
- Optimiere die Vortragsstruktur: Sind wirklich alle Inhalte relevant oder kannst du Unnötiges streichen? Wenn wir ehrlich zu uns sind, dann haben wir meist doch noch zu viele Themen. „Kill your darlings“ ist angesagt. Dieser Schritt wird allzu gerne übergangen, vor allem unter Zeitdruck. Am besten du schläfst noch eine Nacht darüber. Oder du sprichst die Vortragsstruktur mit Kolleg/innen durch. Logische Brüche, unnötige Wiederholungen oder sogar fehlende Inhalte fallen dadurch sofort auf, und du kannst deine Vortragsstruktur jetzt noch einmal anpassen.
Wenn du dieses Problem beim Erstellen wissenschaftlicher Folien gelöst hast, hast du ein klares Vortragskonzept und und kannst gezielt in die Gestaltung einsteigen – ohne dich darin zu verlieren. Das spart Zeit, Nerven und viele überflüssige Schleifen.
Problem 2: Du stimmst die Folieninhalte nicht auf den roten Faden ab
Selbst wenn die Grundstruktur steht, die du wie oben beschrieben ausgearbeitet hast, passiert es schnell: Beim Erstellen wissenschaftlicher Folien entwickeln sich die Inhalte in PowerPoint in eine andere Richtung als das ursprüngliche Vortragskonzept. Du fügst eine Grafik hinzu, schiebst eine Tabelle dazwischen, ergänzt hier noch ein Detail – und am Ende wirkt die Präsentation eher wie eine lose Sammlung von Einzelteilen.
Warum das ein Problem ist
- Verwirrtes Publikum: Wenn Aussagen und Folien nicht zueinander passen, entsteht beim Zuhören Unsicherheit. Niemand weiß, was jetzt wichtig ist und was eigentlich vermittelt werden soll.
- Verwässerte Aussage: Deine Kernaussage verliert an Schärfe, weil sie im Material untergeht, das nicht konsequent auf sie ausgerichtet ist.
- Unprofessionelle Wirkung: Inkonsistente Präsentationen wirken unsauber vorbereitet – das schwächt deine Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit als Expert/in.
So löst du dieses zweite Problem
Knüpfe an die Vortragsstruktur an, die du wie beim ersten Problem beschrieben ausgearbeitet hast. Gehe die einzelnen Punkte durch und destilliere daraus eine Reihe klarer Botschaften. Jede Folie sollte genau eine dieser Botschaften transportieren – die Reihenfolge der Folien sollte eine nachvollziehbare Argumentation ergeben.
Formuliere für jede Folie Action Titles. Das sind aussagekräftige Überschriften, die deine Take-Home-Messages wirksam vermitteln und genau die Inhalte deiner Folien wiedergeben. Anstatt eine Folie „Einleitung“ oder „Ergebnisse“ zu nennen, formulierst du die Überschrift gleich als vollständigen Satz mit Botschaft.
Beispiele:
- Eine Einleitung über fluorhaltige Elektroden könnte statt „Übersicht zu Fluor in Batterien“ wie in Abbildung 2 aus dem Artikel von Meng et al. 2023 1 eher so lauten: „Die chemischen Besonderheiten von Fluor ermöglichen die Entwicklung von stabileren und leistungsfähigeren Batterien“.
- Statt „Dissolutionsprofile von 3D-gedruckten Tabletten“ wie in Abbildung 10 im Artikel von Wang et al. 2024 2 ist folgende Beschreibung viel aussagekräftiger: „Die Dissolutionsprofile von 3D-gedruckten Tabletten bestätigten den Zusammenhang zwischen stärkerer Oberflächenkrümmung und beschleunigter Wirkstofffreisetzung“.
- Ein besserer Action Title für „Abhängigkeit von miRNAs von Alter und Geschlecht“ wie in Abbildung 2 aus dem Artikel von Fehlmann et al. 2020 3 wäre: „miRNA-Profile stehen in stärkerem Zusammenhang mit dem Alter als mit dem Geschlecht“.
Sorge also direkt beim Erstellen wissenschaftlicher Folien dafür, dass der rote Faden direkt erkennbar ist: Wähle Action Titles im Einklang mit deinem Vortragskonzept und deinen Kernbotschaften. Solltest du neue Ideen dabei entwickeln: Halte kurz inne und überlege, ob das inhaltlich passt. Falls ja, dann ergänze das einfach in deinem Strukturkonzept – und weiter geht’s mit dem Foliendesign.
Wenn du dieses Problem beim Erstellen wissenschaftlicher Folien gelöst hast, erfasst dein Publikum anhand der Action Titles sofort den roten Faden deines Vortrages und kann deinen Ausführungen viel besser folgen. Denn: Alle Action Titles ergeben aneinandergereiht die Storyline deines Vortrages – kurz und prägnant und auf den Punkt!
Problem 3: Du ignorierst wesentliche Wahrnehmungsprinzipien
Das dritte Problem beim Erstellen wissenschaftlicher Folien ist: Du fragst dich nicht, wie die Zuhörer/innen deine Folieninhalte subjektiv wahrnehmen und bewerten. Für dich ist jede einzelne Abbildung oder Tabelle klar, du hast dich ja auch schon monatelang – wenn nicht sogar jahrelang – damit beschäftigt. Doch dein Publikum sieht deine Folien zum ersten Mal und muss in kürzester Zeit viele komplexe Informationen verarbeiten.
Warum das ein Problem ist
- Unklare Zusammenhänge: Wenn die Inhalte der Folien visuell nicht gut angeordnet sind und nicht zu den Action Titles passen, gehen wichtige Beziehungen gehen unter und Missverständnisse sind vorprogrammiert.
- Falsche Schlussfolgerungen: Im Extremfall zieht das Publikum aus komplexen oder unübersichtlichen Folien sogar Schlüsse, die du gar nicht beabsichtigt hast.
- Schnelle Überforderung: Wenn zu viele Details gleichzeitig sichtbar sind, wird das Gehirn überlastet – und die eigentliche Botschaft bleibt auf der Strecke.
So löst du dieses dritte Problem
Mach es deinem Publikum so einfach wie möglich: Strukturiere deine Folien so, dass Zusammenhänge eindeutig erkennbar sind. Verzichte auf Grafiken oder Stilelemente, die keinen Informationsgehalt haben und nur hübsch aussehen. Dein Publikum verarbeitet die Folie in Sekunden – du musst die Lesbarkeit und Klarheit aktiv steuern.
Aus der Wahrnehmungspsychologie weiß man, dass unser Gehirn Informationen nach einfachen Kriterien gruppiert. Diese entscheiden dann darüber, ob deine Folien sofort erfasst werden oder nur verwirren. Achte daher vor allem auf die folgenden fünf Gestaltungsprinzipien beim Erstellen wissenschaftlicher Folien4,5.
- Prinzip der Lesbarkeit: Hier geht es vor allem um Schriftgröße, Schriftart und Kontrast, damit der Folientext auch von der letzten Reihe aus lesbar ist.
- Schriftgröße: Eine Schriftgröße von 18-24 pt ist ideal, Überschriften innerhalb des Textes sollten mindestes 4 pt größer sein und Folientitel sollten zwischen 28 und 36 pt sein.
- Schriftart: Serifenlose Schriften wie Arial oder Calibri sind ideal, weil sie keine Schnörkel haben, die beim Lesen von Folientext irritieren könnten.
- Kontrast: Je deutlicher sich die Schrift vom Hintergrund abhebt desto besser. Gut lesbar sind dunkle Schriften auf hellem Untergrund und umgekehrt. Vermeide Wasserzeichen, Muster oder Bilder hinter Text, um die Lesbarkeit zu gewährleisten.
- Prinzip der Menge: Je mehr Text, Grafiken, Schemata, Icons oder Tabellen auf den Folien sind, desto mehr Zeit brauchen die Zuhörer/innen – doch diese ist bei Vorträgen begrenzt. Folgende Tipps helfen dabei die Folien nicht zu überladen.
- Inhalte kürzen: Lösche alles, was nicht zum Verständnis einer Folie beiträgt oder nicht im Vortrag erwähnt wird. Wenn du Action Titles in den Folientitel verwendest, kannst du schon auf so manchen Textblock verzichten und dich auf wichtige Abbildungen oder Tabellen fokussieren.
- Stichworte verwenden: Mit Bulletpoints anstelle ganzer Sätze kannst du die Informationsdichte weiter verringern und die Inhalte Strukturieren – wo nötig auch mit eingerückten Unterpunkten. Allerdings macht das nur bei mehr als drei Aufzählungspunkten Sinn. Andernfalls wäre ein kurzer Fließtext eher angebracht.
- Inhalte verteilen: Wenn auf einer Folie verschieden Aspekte gebracht werden, dann verteile sie besser auf auf mehrere Folien. Schließlich sollte jede Folie idealerweise nur eine einzige Botschaft vermitteln.
- Folien animieren: Falls du Inhalte nicht auf verschiedene Folien verteilen kannst, ist das schrittweise Einblenden von Elementen eine sinnvolle Alternative. Damit kannst du gezielt Akzente setzen, wichtige Aspekte hervorheben oder Zusammenhänge klarmachen. Vermeide unnötige oder übertriebene Animationen, da sie mit der Zeit ihre Wirkung verlieren oder sogar nerven.
- Prinzip der Nähe: Unser Gehirn nimmt nahestehende Elemente automatisch als zusammengehörig wahr. Gruppiere daher alles, was deiner Ansicht nach eine Einheit bildet zu Blöcken – das können Formeln, Texte oder Grafiken sein. Vergrößere dann den Abstand zwischen Blöcken mit unterschiedlichem Inhalt oder zwischen Absätzen von Bulletpointlisten,. Füge bei Bedarf Trennungslinien zwischen Elementen ein oder Rahmen um zusammengehörige Objekte.
- Prinzip der Ähnlichkeit: Auch Elemente mit ähnlicher Form, Farbe oder Größe werden automatisch als zusammengehörig erkannt. Nutze dieses Wahrnehmungsprinzip bewusst, um Inhalte auf deinen Folien mit einer gezielten Farb- oder Formkodierung zu versehen und damit zu clustern. Nicht nur für Balkendiagramme oder Scatterplots. Sondern auch für verschiedene Ebenen bei Überschriften, Hervorhebungen, oder Kästen.
- Prinzip der Ausrichtung: Unser Gehirn interpretiert Konturen und Muster so, dass sie eine geschlossene Linie oder Kontur ergeben. Wenn Objekte auf Folien nicht aneinander ausgerichtet sind, lenkt das ab und sorgt für Unruhe. Nutze Führungslinien in PowerPoint, um beispielsweise Überschriften, Textblöcke, und Grafiken aneinander auszurichten, so dass sie sich in einem imaginären Kasten befinden.
Wenn du dieses Problem beim Erstellen wissenschaftlicher Folien gelöst hast, setzt du die Prinzipien der menschlichen Wahrnehmung bewusst für deinen Vortrag ein. Dein Publikum erkennt Zusammenhänge schneller und kann dir leichter folgen. Du weißt dann genau, wie du mit der richtigen Gestaltung deine Botschaften visuell optimal stützen und die Aufmerksamkeit deiner Zuhörer/innen lenken kannst.
Fazit: So hast du mehr Klarheit beim Erstellen wissenschaftlicher Folien
Ich hoffe, dieser Artikel hat dir gezeigt, dass wirkungsvolle Folien kein Zufallsprodukt sind, sondern das Ergebnis klarer Entscheidungen – Schritt für Schritt. Denn gute Daten wirken erst, wenn du sie klar strukturierst und sichtbar machst. Wenn du zuerst deinen roten Faden entwickelst, die Folien konsequent auf deine Botschaften ausrichtest und grundlegende Wahrnehmungsprinzipien beachtest, entsteht eine Präsentation, die verständlich ist und in Erinnerung bleibt. Du sparst Zeit und Nerven, weil du zielgerichtet arbeitest – und dein Publikum bekommt einen Vortrag, der führt statt überfordert. So erhöhst du die Chance, dass deine Ergebnisse dort ankommen, wo sie hingehören: im Kopf deiner Zuhörer/innen.
Referenzen:
- J. Meng et al. 2023 Fluorinated electrode materials for high-energy batteries.
Matter, Volume 6, Issue 6, 1685 – 1716 (https://www.cell.com/matter/fulltext/S2590-2385(23)00163-7) ↩︎ - H. Wang, I. Karnik, P. Uttreja, P. Zhang, S.K. Vemula & M. A. Repka 2024 Development of Mathematical Function Control-Based 3D Printed Tablets and Effect on Drug Release. Pharm Res 41, 2235–2246 (https://doi.org/10.1007/s11095-024-03780-5) ↩︎
- T. Fehlmann et al. 2020 Common diseases alter the physiological age-related blood microRNA profile. Nat Commun 11, 5958 (https://doi.org/10.1038/s41467-020-19665-1) ↩︎
- B. Hey 2019 Präsentieren in Wissenschaft und Forschung. Springer Gabler, Berlin, Heidelberg (https://doi.org/10.1007/978-3-662-53609-4_4) ↩︎
- H. Lobin 2012 Die wissenschaftliche Präsentation. Schöningh, Paderborn (https://www.utb.de/doi/book/10.36198/9783838537702) ↩︎